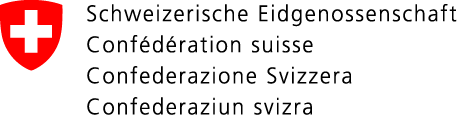Fragen zur Umsetzung
Die Gesetzesbestimmungen für einen besseren Schutz von Mensch und Umwelt im Obligationenrecht (OR), die das Parlament im Juni 2020 als Gegenvorschlag zur Volksinitiative "für verantwortungsvolle Unternehmen" beschlossen hat, sehen zwei Neuerungen vor: Zum einen werden grosse Schweizer Unternehmen erstmals gesetzlich verpflichtet, über die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit in den Bereichen Umwelt, Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Bekämpfung der Korruption sowie über die dagegen ergriffenen Massnahmen Bericht zu erstatten und damit Transparenz zu schaffen (sogenannte nicht-finanzielle Berichterstattung). Zum anderen müssen Unternehmen mit Risiken in den sensiblen Bereichen der Kinderarbeit und der sogenannten Konfliktmineralien besondere und weitgehende Sorgfaltspflichten einhalten. Diese Sorgfaltspflichtenregelungen müssen auf Verordnungsstufe mit Ausführungsbestimmungen umgesetzt werden, wobei diese nicht über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen dürfen. Der Bundesrat hat die entsprechende Verordnung bis am 14. Juli 2021 in die Vernehmlassung geschickt. Der Gegenvorschlag des Parlaments kommt – vorbehältlich des Referendums – zum Zug, weil die weitergehende Volksinitiative im November 2020 in der Volksabstimmung verworfen wurde; die Referendumsfrist endet am 5. August 2021.
Der Entwurf der "Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit (VSoTr)" regelt namentlich, welche Unternehmen diese neuen Sorgfaltspflichten erfüllen müssen. Im Bereich der sogenannten Konfliktmineralien legt die Verordnung die jährlichen Einfuhr- und Bearbeitungsmengen für Mineralien und Metalle fest, bis zu denen ein Unternehmen von der Sorgfalts- und Berichterstattungspflicht betreffend Konfliktmineralien befreit ist. Die entsprechenden Ausführungsbestimmungen in der Verordnung orientieren sich an den in der EU geltenden Schwellenwerten (EU 2017/821). Im Bereich der Kinderarbeit enthält die Verordnung die vom Gesetz verlangten Ausnahmen von den Sorgfalts- und Berichterstattungspflichten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für Unternehmen mit geringen Risiken in diesem Bereich. Schliesslich konkretisiert die Verordnung die einzelnen Sorgfaltspflichten und nennt die massgebenden international anerkannten Regelwerke. Bei den Ausnahmen für die KMU orientiert sich die Verordnung an den Schwellenwerten, wie sie heute für die ordentliche Revision der Jahresrechnung gelten.
Das Parlament und der Bundesrat haben sich mit dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative "für verantwortungsvolle Unternehmen" für eine international abgestimmte Regulierung ausgesprochen. Deshalb orientieren sich der indirekte Gegenvorschlag und damit auch die Ausführungsbestimmungen in der Verordnung an den Regeln, wie sie heute in der EU gelten. Das ist einerseits die EU-Richtlinie 2014/95 betreffend die nicht-finanzielle Berichterstattung und andererseits die EU-Richtlinie "zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten" (sogenannte Konfliktmineralien). Im Bereich der Kinderarbeit geht die Schweiz einen Schritt weiter als die EU. Anderweitige, teilweise weitergehende Regelungen in einzelnen Ländern sind nicht direkt vergleichbar. So sehen z.B. Deutschland und Frankreich zwar allgemeinere Sorgfaltspflichten als die Schweiz vor, aber auch deutlich höhere Schwellenwerte.
Derzeit wertet das Bundesamt für Justiz die Eingaben aus der Vernehmlassung zur "Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit (VSoTr)" aus. Nach heutiger Planung soll der Bundesrat wenn möglich noch in diesem Jahr die Ausführungsbestimmungen zu den Sorgfaltspflichten beschliessen und die Bestimmungen des Gegenvorschlags in Kraft setzen. Das Gesetz gewährt den Unternehmen anschliessend ein Jahr, um sich auf die neuen Pflichten einzustellen (2022). Die neuen Pflichten könnten damit erstmals auf das Geschäftsjahr 2023 Anwendung finden.
Fragen zur Abstimmung
Die Initiative verlangt, dass Schweizer Unternehmen prüfen, ob im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die international anerkannten Menschenrechte und Umweltstandards auch im Ausland eingehalten werden. Dies beinhaltet auch, dass sie die Tätigkeit ihrer Tochtergesellschaften, Zulieferer und Geschäftspartner überprüfen und falls notwendig Massnahmen ergreifen sowie darüber Bericht erstatten. Zudem würden die Schweizer Unternehmen künftig nicht nur für selber verursachte Schäden haften, sondern auch für Schäden, die von ihnen kontrollierte Unternehmen, wie beispielsweise eine Tochtergesellschaft oder ein wirtschaftlich abhängiger Zulieferer, insbesondere im Ausland, verursachen.
Für den Bundesrat ist klar, dass Schweizer Unternehmen die Menschenrechte und die Umweltvorschriften auch im Ausland einhalten müssen. Die Initiative geht aber zu weit und würde zu einem Alleingang der Schweiz führen. Dies betrifft vor allem die zusätzliche Haftungsregelung, welche die Initiative vorsieht. Unternehmen können die Regulierung umgehen, indem sie ihren Sitz ins Ausland verlegen. Damit schwächt die Initiative den Wirtschaftsstandort Schweiz und gefährdet Arbeitsplätze. Die Initiative bestraft zudem nicht nur einige wenige Konzerne, sondern potenziell auch alle verantwortungsvoll handelnden Schweizer Unternehmen, obwohl diese einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung auch in Entwicklungsländern leisten. Auch dem Parlament geht die Initiative zu weit. Deshalb hat es einen indirekten Gegenvorschlag verabschiedet, der international abgestimmt ist, und den auch der Bundesrat unterstützt. Dieser tritt jedoch nur in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird und ein allfälliges Referendum gegen den indirekten Gegenvorschlag scheitert.
Der indirekte Gegenvorschlag nimmt die Unternehmen ebenfalls deutlich stärker in die Pflicht als bisher, er verfolgt dabei aber einen international abgestimmten Ansatz. Er schafft mit der Berichterstattungspflicht erstmals verbindliche Transparenzvorschriften in sozialen, menschenrechtlichen und ökologischen Belangen. In den besonders sensiblen Bereichen Kinderarbeit und Konfliktmineralien verlangt der Gegenvorschlag von den Unternehmen zudem neu, dass sie eine Sorgfaltsprüfung durchführen, und geht damit noch einen Schritt weiter als die EU.
Ja. Verursacht ein Schweizer Unternehmen im Ausland einen Schaden, haftet es aber grundsätzlich nach dem dortigen Recht. Verursacht eine Tochtergesellschaft den Schaden, dann haftet sie. Die Initiative verlangt hingegen, dass in einem solchen Fall die Schweizer Muttergesellschaft haften würde. Dies hätte einen internationalen Alleingang der Schweiz zu Folge und würde Arbeitsplätze in der Schweiz wie auch im Ausland gefährden. Mit dem Gegenvorschlag würden bei der Haftung weiterhin dieselben, international anerkannten Rechtsgrundsätzen wie heute gelten: Jedes Unternehmen haftet für einen Schaden in der Regel selber und gemäss dem Recht, das am Schadensort gilt.
Die Initiative betrifft grundsätzlich sämtliche Schweizer Unternehmen. Ausnahmen soll es gemäss dem Initiativtext nur für KMU geben, die geringe Risiken aufweisen (z.B. eine mittelgrosse, national tätige Immobiliengesellschaft). Auf sie soll der Gesetzgeber bei der Umsetzung der Sorgfaltsprüfungspflicht Rücksicht nehmen. Wie viele KMU dies sind, lässt sich heute nicht abschätzen. Vom Gegenvorschlag wären insgesamt sicherlich weniger Unternehmen betroffen. KMU wären insbesondere von der Berichterstattungspflicht ausgenommen, weil diese nur für kotierte Unternehmen sowie Finanzunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden gelten würde. Von der Sorgfaltsprüfungspflicht im Bereich Kinderarbeit wären hingegen grundsätzlich alle Unternehmen erfasst, mit Ausnahme von KMU und Unternehmen mit tiefen Risiken. Bei der Sorgfaltsprüfungspflicht im Bereich der Konfliktmineralien hängt die Zahl der betroffenen Unternehmen von den Einfuhrmengen ab. Massgebend werden auch hier die Ausführungsbestimmungen zum Gegenvorschlag sein, die erst nach einer allfälligen Ablehnung der Initiative durch die Bevölkerung erarbeitet werden.
Die Berichterstattungspflicht umfasst die Themenbereiche Umwelt, Soziales, Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung. Ein Unternehmen muss dazu jährlich einen Bericht erstellen, in dem es darüber informiert, wie sich seine geschäftlichen Tätigkeiten auf diese Themenbereiche auswirken. Die Berichte müssen für mindestens zehn Jahre öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies schafft Transparenz, erleichtert es, Missstände zu erkennen und ermöglicht damit Investorinnen und Investoren, aber auch Konsumentinnen oder Konsumenten, verantwortungsvolle Entscheide zu treffen. Der Gegenvorschlag sieht zudem eine strafrechtliche Sanktion in Form einer Busse bis zu 100 000 Franken vor, wenn ein Unternehmen die Berichterstattungspflicht verletzt.
Bei den Bereichen "Kinderarbeit" und "Konfliktmineralien" handelt es sich um besonders sensible Bereiche. Deshalb will der Gegenvorschlag, dass die Schweizer Unternehmen hier besonders gut hinschauen. Mit der Sorgfaltsprüfungspflicht muss ein Unternehmen wissen, unter welchen Bedingungen beispielswiese ein Lieferant arbeitet, von dem es Produkte bezieht. So können Mineralien z. B. aus einen Kriegsgebiet stammen, so dass mit dem Handel gleichzeitig Konflikte mitfinanziert werden. Auch bei einem Verdacht auf Kinderarbeit muss ein Unternehmen Massnahmen ergreifen. Mit diesen Sorgfaltspflichten soll sichergestellt werden, dass Unternehmen beispielsweise keine Lieferanten berücksichtigen, die sich nicht an die Regeln halten. Über die Sorgfaltsprüfung müssen die betroffenen Unternehmen ebenfalls jährlich Bericht erstatten. Auch hier macht sich strafbar, wer diese Berichterstattungspflicht verletzt.
Nein. Eine derart explizite Konzernhaftung, wie sie die Initiative verlangt, kennt kein Land. Frankreich hat zwar ein relativ weitgehendes Gesetz, das aber nur für Unternehmen gilt, die mindestens 5000 Mitarbeiter in Frankreich oder 10 000 Mitarbeiter weltweit haben. Auch die Haftungsregelung in Frankreich ist nicht vergleichbar mit derjenigen, welche die KVI fordert. Zudem trägt in Frankreich der Kläger die ganze Beweislast. In der EU und in Deutschland laufen derzeit zwar Diskussionen über verbindlichere Regulierungen im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte, diese sind jedoch umstritten und konkrete Gesetzesprojekte liegen noch nicht vor.
Letzte Änderung 09.07.2021